Das 2005 ins Leben gerufene und alle 5 Jahre wiederholte Projekt reGeneration widmet sich der aufstrebenden internationalen Fotografie. Wie entstand die Idee und was steht im Mittelpunkt dieses Vorhabens?
Lydia Droner und Pauline Martin: Im Jahr 2005, als das Musée de l’Elysée sein 20-jähriges Bestehen feierte, bevorzugte der damalige Direktor William A. Ewing einen «Blick in die Zukunft» – anstelle des eher erwarteten «rückblickenden Blicks». Es ging nicht darum zu sehen, was das Musée de l’Elysée seit 20 Jahren gemacht hatte, sondern was Fotografie in 20 Jahren sein könnte. Seine Idee war es, eine Wette auf die Zukunft abzuschliessen: Wer würden die grossen Namen der Fotografie von morgen sein? Im Jahr 2010, anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des Museums, wollte er die Übung wiederholen. Inzwischen ist daraus ein echtes Programm geworden, das es alle 5 Jahre erlaubt, eine Art „Standbild“ einer im Entstehen begriffenen internationalen Schöpfung zu machen.
Was sind die Themen von reGeneration4?
Im Gegensatz zu den drei vorhergehenden Ausgaben haben wir beschlossen, die Ausschreibung nicht über die Schulen, sondern über die Künstlerinnen und Künstler, die bereits an reGeneration1, 2 und 3 teilgenommen haben, durchzuführen. So haben wir die 180 Fotografen erneut mit einem doppelten Ziel kontaktiert: Wir wollten herauszufinden, wie sich ihre Karriere entwickelt hat und welchen Herausforderungen sie heute bei der Ausübung ihres Berufs gegenüberstehen. In diesem Kontext haben wir sie gebeten, uns Kandidaten für diese vierte Ausgabe einzureichen. Die Herausforderung bestand für uns nicht so sehr darin, „die Fotografen von morgen“ kennen zu lernen, sondern zu verstehen, was die Anliegen der Fotografen von heute und eigentlich eines Museums, das sich ihrem Medium widmet, am Vorabend unseres Umzugs zur PLAETFORME10 sein könnten.
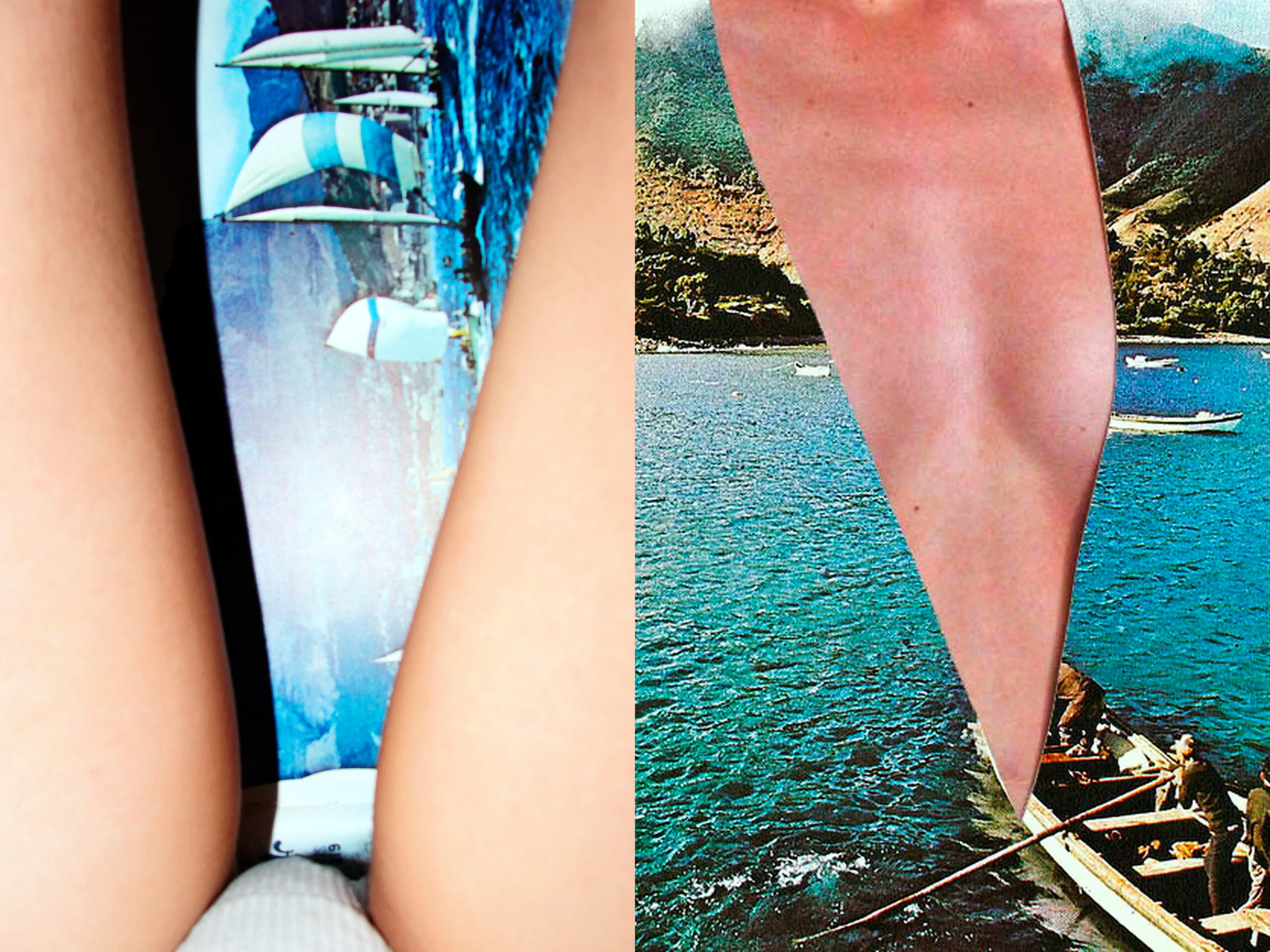
Das Wort „re“ impliziert bereits den reflexiven Charakter des Projekts, der in der Namensgebung präsent ist und sich als ein «Think Tank für Fragen nicht nur der zeitgenössischen Fotografie, sondern auch der Rolle ihres Museums heute» versteht. Welche Themen werden diskutiert?
Die Ausstellung ist als ein Laboratorium musealer und kuratorischer Praktiken konzipiert. Nach der Lektüre der Künstlerdossiers haben wir 4 Achsen identifiziert, die wiederum als Architektur der Ausstellung dienten: Engagement, Digitale Diffusion, Gleichstellung & Gender und Ökologie.
Die erste Achse ist die Frage nach dem Engagement und der Form, die es heute bei der Unterstützung von Fotografen annehmen sollte. Auch die Frage des Umweltschutzes ist schnell zu einem Schlüsselthema geworden, ebenso wie die Frage der Gleichstellung von Männern und Frauen im Bereich der Fotografie. Schliesslich erschienen auch die Fragen, die durch die digitale Verbreitung, die gemeinsame Nutzung von Daten und die Art und Weise, wie Algorithmen unsere Entscheidungen beeinflussen, aufgeworfen werden, zentral.
«Es ging nicht darum zu sehen, was das Musée de l’Elysée seit 20 Jahren gemacht hatte, sondern was Fotografie in 20 Jahren sein könnte.»
Die Frage nach der ökologischen Rolle des Museums ist Programm: reGeneration4 ist die allererste CO2-neutral gestaltete Ausstellung. Was bedeutet das, und was sollten wir daraus für die Fotografie von morgen lernen?
Wir haben jeden einzelnen Produktionsschritt der Ausstellung in Frage gestellt (Rahmung, Druck, Transport, Besuchsführer, Eröffnung usw.), um uns über unsere Praktiken bewusst zu werden und um zu sehen, ob wir ihre Auswirkungen auf die CO2-Emissionen reduzieren können. Wir stellten fest, dass die Fotografinnen und Fotografen sehr offen waren, um über die Form ihrer Arbeit zu diskutieren, die letztlich ökologisch verantwortungsvoller sein sollte. Wahrscheinlich müssen wir diesen Dialog mit den Künstlern in unsere Gewohnheiten einführen, um auch bestimmte vorgefasste Meinungen, wie etwa den Vorrang des Grossformats, umzuwandeln.
Zweifellos sollten alle Anstrengungen unternommen werden, um sicherzustellen, dass Aufrufe zur Einreichung von Bewerbungen dieser Art oder Wettbewerbe für einen Preis beispielsweise für alle zugänglich sind. Wenn wir von Beginn des Prozesses an Chancengleichheit anstreben können, ohne während des Auswahlverfahrens auf Quoten zurückzugreifen, und wenn dies ein Reflex und kein Zwang ist, könnte unsere Rolle in dieser äusserst wichtigen Frage erreicht werden. Unsere Ausschreibung gab daher vor, jeweils die gleiche Anzahl weiblicher und männlicher Fotografen zu benennen.
In Reaktion auf aktuelle Debatten wirft reGeneration4 ferner einen Blick in die Zukunft. Was sind die grossen Herausforderungen für Schweizer Fotografinnen und Fotografen?
Das betrifft wahrscheinlich alle Künstlerinnen und Künstler, nicht nur die Schweizer Fotografinnen und Fotografen. Ein wichtiges Anliegen, das in den Antworten auf unseren Fragebogen aufkam, war die Ökonomie des Berufs. Wir können einem Künstler nicht mehr antworten, dass die blosse Ausstellung seines Werkes ihm eine Rendite seiner Investition garantiert. Die Pressewelt zahlt weniger als früher, der Markt ist gesättigt. Das Engagement des Musée de l’Elysée in dieser Frage hat zur Entwicklung einer Honorarordnung geführt, um alle an einer Gruppenausstellung teilnehmenden Künstler gerecht und systematisch zu entlohnen, zusätzlich zu den Produktions- und Erwerbskosten, die ebenfalls von der Institution getragen werden.

Was sind Ihre Ideen für die Zukunft des Fotomuseums? Und welche Rolle spielt in diesem Kontext die Kurator*innen, und warum könnte sie – in einer von Bildern gesättigten Welt – immer wichtiger werden?
Neben der Erhaltung des Kulturerbes besteht die Rolle des Museums darin, Sinn zu machen, Fragen zu stellen und eine aktive Rolle in der Gesellschaft und ihrer Veränderung zu übernehmen. Diese Herausforderung ist heute wichtig, denn das Internet bewirkt, dass wir sowohl in einer Fülle von Bildern ertrinken als auch glauben, dass es unsere Informationsmöglichkeiten, Wahlmöglichkeiten und so weiter vervielfacht. Tatsächlich ist es oft umgekehrt, denn ohne die Möglichkeit, sich von der Art und Weise, wie das Internet funktioniert, zurückzuziehen, ist man schnell verloren und ohne Bezugspunkte. Das ist eine echte Gefahr für die Gesellschaft.
«Die Rolle des Museums besteht darin, Sinn zu machen, Fragen zu stellen und eine aktive Rolle in der Gesellschaft und ihrer Veränderung zu übernehmen.»
Schliesslich ist die digitale Kultur auch ein zentrales Thema dieser Ausgabe, die ein virtuelles Pendant in Form einer Web-Plattform lanciert. Wie unterscheidet sich dieses digitale Ausstellungsformat von dem analogen respektive physischen Erlebnis im Museum?
Wir haben eine Website erstellt, die die Ausstellung und die Publikation ergänzt, aber nicht überschneidet. Wir wollten die Bedeutung der Gemeinschaft von Fotografen, Institutionen, Schulen und Fachleuten aufzeigen, die durch 15 Jahre Re-Generation entstanden ist. Die Website schafft keine Inhalte an sich, sondern bietet Zugang zu einem ganzen Netz von Informationen, die bereits im Internet vorhanden sind.
Betrachten Menschen Fotografien physisch im Museum anders, als wenn sie diesen auf Social Media oder im digitalen Kontext begegnen?
Wir haben festgestellt, dass Fotografen sehr darauf bedacht sind, ihren Werken eine physische Form im Raum zu geben, um Botschaften zu manchmal sehr komplexen gesellschaftlichen Themen auf sinnliche Weise zu vermitteln. In diesem Bereich muss das Museum in der Lage sein, sich zu engagieren, um diesen Werken eine Existenzberechtigung zu geben. Wir haben auch ein interessantes Hin- und Herspiel zwischen dem Internet und dem Museum beobachtet. Zum Beispiel entstehen einige Werke auf Instagram, in einer Form, die durch das soziale Netzwerk generiert wird. Dann werden sie gedruckt, um an die Wände gehängt zu werden, dann wieder fotografiert und in sozialen Netzwerken ausgetauscht.
Zu welchem Ergebnis kann die Ausstellung im Idealfall führen?
Die wichtigste Schlussfolgerung der Ausstellung besteht zweifellos darin, dass es wichtig ist, die eigenen Praktiken ständig zu hinterfragen, um möglichst kohärent zu sein zwischen dem, was man in einer Ausstellung zeigt, und dem, was man als öffentliche Institution tut.

Wenn dir dieser Beitrag gefallen hat, drücke auf das Herz.










